Globale Umweltprobleme wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und Verlust biologischer Vielfalt lassen sich nicht durch isolierte Technologien lösen. Einzelne Anwendungen wie Solaranlagen, E-Autos oder Recyclingzentren reichen nicht aus, weil ökologische Herausforderungen systemisch und miteinander verwoben auftreten. Dieser Zusammenhang erfordert technische und organisatorische Antworten, die ebenfalls vernetzt und aufeinander abgestimmt funktionieren. Genau an diesem Punkt setzt das Konzept der Systems-of-Systems an, abgekürzt SoS. Die zugrundeliegende Idee: mehrere unabhängig funktionierende Teilsysteme werden zu einem übergeordneten Gesamtsystem integriert, das größere und komplexere Aufgaben bewältigen kann.
Warum Systems-of-Systems für die Umwelt unverzichtbar werden
Definition und Grundprinzipien von Systems-of-Systems
Ein System-of-Systems besteht aus mehreren eigenständigen Systemen, die zusammenarbeiten, aber jeweils ihre eigene Struktur und Zielsetzung behalten. Im Umweltkontext bedeutet das zum Beispiel: Smart Grids, Sensoriknetzwerke, Abfallmanagement und Mobilitätssysteme werden nicht zentralisiert gesteuert, sondern interagieren flexibel miteinander. Charakteristisch ist dabei, dass diese Systeme eigenständig bleiben, aber durch gemeinsame Datenstrukturen, Schnittstellen und Protokolle miteinander verbunden werden. Dadurch entsteht eine hybride Architektur, die besser skalierbar, robuster gegen Ausfälle und anpassungsfähiger ist als monolithische Großsysteme.
Systemische Nachhaltigkeit als Zielgröße
Der Begriff Umwelt-Nachhaltigkeit wird häufig auf einzelne Aspekte reduziert: CO₂-Einsparung, Kreislaufwirtschaft oder Ressourcenschonung. Systems-of-Systems zielen darauf ab, diese Dimensionen ganzheitlich zusammenzudenken. Das bedeutet zum Beispiel, dass ein Sensorennetz zur Luftqualitätsmessung gleichzeitig Einfluss auf Verkehrssysteme, Energiemanagement und Gebäudesteuerung haben kann. Dadurch entsteht ein nachhaltiger Gesamteffekt, der sich aus der Wechselwirkung vieler kleiner Systeme speist. Die zugrunde liegende Studie analysiert genau diese übergreifenden Strukturmuster und legt damit eine methodisch fundierte Kartierung der bisherigen SoS-Ansätze im Umweltbereich vor.
Warum ein systematisches Mapping notwendig ist
Die Forschung zu Systems-of-Systems ist bislang stark fragmentiert. Viele Publikationen behandeln einzelne Teilbereiche wie Smart Cities, autonome Fahrzeuge oder Energieplattformen, ohne sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Genau hier setzt die systematische Mapping-Studie an. Mithilfe einer strukturierten Suchstrategie wurden wissenschaftliche Arbeiten aus vier einschlägigen Datenbanken ausgewertet und nach definierten Kriterien klassifiziert. Ziel war es, ein möglichst vollständiges Bild der aktuellen SoS-Forschung im Umweltbereich zu gewinnen, um Trends, Lücken und Prioritäten zu identifizieren. Das Ergebnis ist ein Überblick, der sowohl technische wie auch organisatorische Aspekte von Umwelt-SoS abdeckt.
Kernfragen der Mapping-Studie
Die zentrale Leitfrage der Analyse lautete: In welchen Umweltbereichen werden Systems-of-Systems eingesetzt und welche technologischen, sozialen und organisatorischen Muster sind dabei erkennbar? Darüber hinaus wurde untersucht, welche Systemarten besonders häufig integriert werden, welche Herausforderungen in Bezug auf Datenmanagement und Interoperabilität bestehen und welche Anwendungsfelder bislang vernachlässigt wurden. Die Kombination dieser Fragestellungen ergibt ein differenziertes Bild, das sich sowohl an Forschende als auch an politische Entscheidungsträger richtet. Es zeigt nicht nur, wo Umwelt-Systemintegration bereits funktioniert, sondern auch, wo strukturelle Innovationsdefizite bestehen.
Hauptbefund: Dominanz urbaner Anwendungen
Einer der auffälligsten Befunde der Studie ist die starke Fokussierung bestehender SoS-Forschung auf urbane Umweltsysteme. Insbesondere Smart Cities, intelligente Stromnetze und Verkehrsmanagement dominieren die wissenschaftliche Literatur. Andere Felder wie nachhaltige Landwirtschaft, Waldschutz oder Biodiversitätsmonitoring sind hingegen unterrepräsentiert. Diese Schieflage erklärt sich teilweise aus der einfacheren Datenverfügbarkeit und der höheren politischen Priorisierung städtischer Themen. Gleichzeitig wird dadurch aber ein erhebliches Potenzial für systemische Umweltlösungen außerhalb des urbanen Raums verschenkt. Die Studie plädiert daher für gezielte Forschungsförderung in bislang vernachlässigten Sektoren.
Wachsende Relevanz durch Klimadruck und Digitalisierung
Die Bedeutung von Systems-of-Systems für Umweltfragen wird durch zwei parallele Trends verstärkt. Erstens zwingt der fortschreitende Klimawandel zu immer umfassenderen Anpassungsstrategien, die über Sektoren- und Landesgrenzen hinweg greifen müssen. Zweitens ermöglicht die fortschreitende Digitalisierung eine Integration, die technisch vor wenigen Jahren noch nicht realisierbar gewesen wäre. Cloud-Plattformen, Big-Data-Analysen und KI-gesteuerte Steuerungssysteme machen es heute möglich, selbst sehr heterogene Umweltsysteme effizient zu koppeln und dynamisch zu steuern. Diese technischen Voraussetzungen treffen auf einen gesellschaftlichen Bedarf an systemischer Resilienz und Nachhaltigkeit.
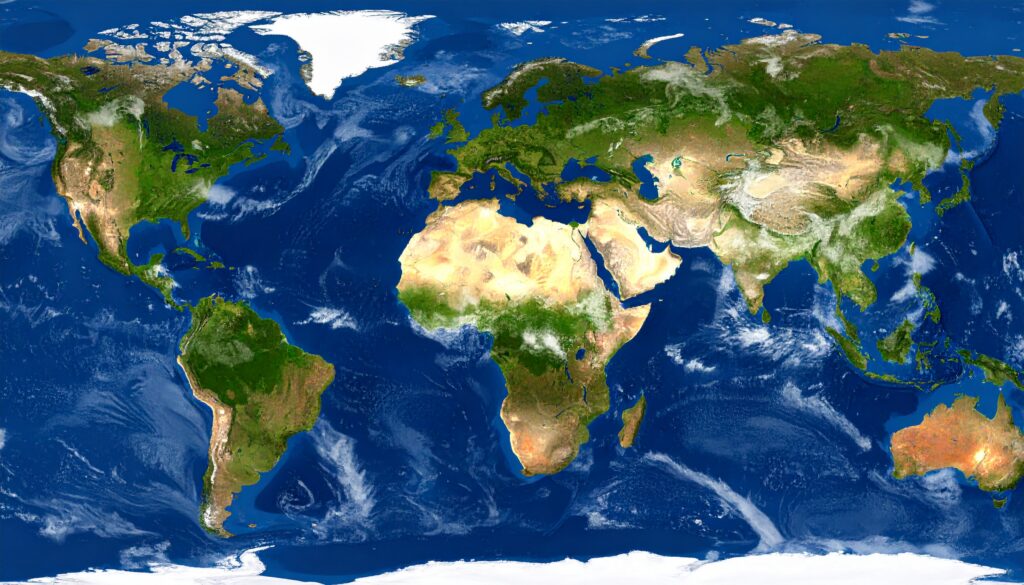
Systematische Kartierung von Systems‑of‑Systems: Methodik und Datenbasis
Grundprinzipien der systematischen Mapping-Studie
Um die Forschung zu Systems‑of‑Systems im Umweltbereich zuverlässig auszuwerten, reicht keine einfache Literaturrecherche. Die Autoren der Studie setzten auf eine strukturierte Methodik, die sich an der etablierten Vorgehensweise nach Kitchenham und Charters orientiert. Diese Mapping-Studien unterscheiden sich von klassischen Reviews durch einen breiteren Fokus und die Zielsetzung, ein möglichst vollständiges Bild eines Forschungsfeldes zu erstellen. Statt nur die Wirkung einer Technologie zu bewerten, geht es darum, welche Themen überhaupt wie oft und in welcher Tiefe behandelt werden. Die gewählte Methode ermöglicht eine objektive Einschätzung der Forschungslandschaft und identifiziert klare Schwerpunkte und Leerstellen.
Datenquellen und Suchstrategie
Für die systematische Kartierung wurden vier internationale Datenbanken herangezogen: IEEE Xplore, Scopus, Web of Science und Google Scholar. Dabei kamen Suchbegriffe zum Einsatz, die auf „Systems-of-Systems“ und „Environmental Sustainability“ kombiniert wurden, ergänzt um verwandte Termini wie „Smart Grid“, „Urban Sustainability“ oder „Resource Efficiency“. Um ausschließlich relevante und methodisch hochwertige Arbeiten zu erfassen, wurden nur Peer-Review-Veröffentlichungen einbezogen, die zwischen 2018 und 2024 erschienen sind. Diese Einschränkung sollte sicherstellen, dass die ausgewertete Literatur aktuelle Trends und Technologien abbildet.
Auswahl- und Filterprozesse
Die initiale Recherche lieferte über 1200 Treffer. Durch eine Kombination aus automatisierten Textfiltern und manueller Prüfung wurde diese Zahl auf 39 Kernstudien reduziert, die den definierten Kriterien vollständig entsprachen. Relevanzentscheidungen basierten auf Abstract-Analyse und vollständigem Lesen der Arbeiten, wobei besonderes Augenmerk auf den expliziten System-of-Systems-Bezug gelegt wurde. Arbeiten, die lediglich Systeme im klassischen Sinn, aber keine SoS-Strukturen behandelten, wurden ausgeschlossen. Ebenso wurden Studien, die sich auf nicht-umweltbezogene Anwendungen wie Militär- oder Luftfahrttechnik konzentrierten, nicht weiter berücksichtigt.
Kategorisierung der identifizierten Studien
Die verbleibenden 39 Arbeiten wurden anschließend inhaltlich codiert. Dabei untersuchten die Autoren jeweils, in welchem Umweltsektor die SoS-Anwendung verortet ist, welche Systemtypen integriert werden, welche methodischen Ansätze verwendet wurden und welche technischen oder organisatorischen Herausforderungen thematisiert werden. Zusätzlich wurde erfasst, ob die Studien eher konzeptionell, simulationsbasiert oder empirisch ausgerichtet sind. Diese feingliedrige Kodierung ermöglichte eine quantitative und qualitative Auswertung der Forschungslandschaft und erlaubte eine transparente Visualisierung der gefundenen Muster.
Quantitative Ergebnisse der Kartierung
Ein wesentliches Ergebnis der Auswertung war, dass 68 % der Studien sich auf urbane Kontexte konzentrieren, wobei Smart Grids und Smart Cities die am häufigsten untersuchten SoS-Formate darstellen. Weitere 18 % befassen sich mit überregionalen Energiesystemen, während nur 14 % den Bereich Landwirtschaft, Waldschutz oder Biodiversität abdecken. Methodisch dominierten Simulationsstudien mit 59 %, gefolgt von konzeptionellen Arbeiten mit 28 % und empirischen Fallstudien mit nur 13 %. Diese Verteilung deutet darauf hin, dass das Feld noch stark theoriebasiert ist und bisher wenig praktische Umsetzung oder direkte Feldforschung stattgefunden hat.
Stärken und Schwächen der Datenlage
Die systematische Kartierung liefert ein belastbares Bild der aktuellen Forschungslage, offenbart jedoch auch deutliche Lücken. Besonders auffällig ist der Mangel an empirischer Validierung der diskutierten SoS-Modelle. Viele Konzepte existieren bislang nur auf dem Papier oder in Computersimulationen, ohne dass reale Anwendungsbeispiele umfassend dokumentiert wären. Gleichzeitig zeigt sich eine klare thematische Schieflage zugunsten urbaner Energie- und Mobilitätsfragen. Nachhaltige Landwirtschaft, Wasserressourcenmanagement oder Schutz natürlicher Ökosysteme finden sich deutlich seltener, obwohl gerade diese Bereiche für globale Nachhaltigkeitsziele entscheidend sind.
Methodische Grenzen und Ausblick
Wie jede systematische Analyse bleibt auch diese Studie abhängig von den gewählten Suchbegriffen, Datenbanken und Filterkriterien. Mögliche Relevanzverluste durch Terminologieunterschiede oder Sprachbarrieren sind nicht ausgeschlossen. Ebenso wurde auf eine rein englischsprachige Literaturanalyse beschränkt. Dennoch liefert die Arbeit einen wichtigen Grundstein für die weitere Forschung, da sie nicht nur Bestandsaufnahme, sondern auch Orientierung für zukünftige Studien bietet. Sie zeigt, wo sich Investitionen in Forschung und Praxis besonders lohnen und wo strukturelle Defizite bestehen, die eine gezielte Förderung erforderlich machen.

Smart Cities und Smart Grids als dominante Anwendungsfelder
Urbane Nachhaltigkeit im Zentrum der SoS-Forschung
Ein zentrales Ergebnis der systematischen Kartierung besteht darin, dass die Mehrheit der analysierten Systems-of-Systems-Anwendungen im Bereich urbaner Nachhaltigkeit verortet ist. Smart Cities und Smart Grids dominieren klar. Dieser Fokus erklärt sich aus der Tatsache, dass Städte weltweit nicht nur die größten Verursacher von Emissionen sind, sondern auch die komplexesten technischen Infrastrukturen besitzen. Diese doppelte Rolle macht sie zum bevorzugten Testfeld für integrierte Systemansätze, die Umweltziele mit Effizienzsteigerung und Bürgerbeteiligung verbinden sollen.
Smart Grids als Grundlage urbaner Systemintegration
Ein Smart Grid beschreibt ein intelligentes Stromnetz, das Angebot und Nachfrage in Echtzeit aufeinander abstimmt. Im Kontext von Systems-of-Systems bedeutet das: lokale Erzeuger wie Photovoltaikanlagen, Energiespeicher, Verbraucher und Netzbetreiber bilden zusammen ein dynamisch gesteuertes Gesamtsystem. Die Kartierungsstudie zeigt, dass mehr als die Hälfte der untersuchten Smart-City-Projekte auf Smart-Grids-Komponenten aufbauen. Entscheidend ist dabei nicht nur die Integration der Energiesysteme selbst, sondern auch deren Verknüpfung mit weiteren urbanen Subsystemen, etwa Gebäudesteuerung, Verkehrsmanagement oder Wasserversorgung. Smart Grids fungieren somit als infrastrukturelles Rückgrat für umfassendere SoS-Strategien.
Beispiele für urbane SoS-Initiativen
In der Kartierung wurden verschiedene real existierende Smart-City-Projekte analysiert. Besonders häufig genannt wurden Barcelona, Singapur und Amsterdam. Diese Städte verfügen über ausgereifte SoS-Strukturen, in denen Energie, Mobilität und Umweltüberwachung gekoppelt sind. Sensoriknetzwerke zur Luftqualitätsmessung kommunizieren mit Verkehrsampeln und öffentlichen Verkehrssystemen. Gebäudeautomatisierung reagiert auf Strompreise und Wetterdaten. Derartige Beispiele zeigen das Potenzial integrierter Ansätze für Ressourceneinsparung und Emissionsreduzierung. Auffällig bleibt allerdings, dass diese Modelle fast ausschließlich in hochentwickelten, wohlhabenden Metropolen zu finden sind.
Mobilität als zweites Hauptthema innerhalb urbaner Systeme
Neben Energie gehört Mobilität zu den am häufigsten adressierten Themenfeldern. Die Kartierung zeigt, dass nahezu jedes dritte urbane SoS-Modell Elemente wie Car-Sharing, intelligente Verkehrssteuerung oder autonomes Fahren integriert. Besonders dynamisch entwickelt sich das Zusammenspiel zwischen Verkehrsmanagement und Energienetzen, etwa durch Elektromobilität. Ladeinfrastruktur, Batterien und Fahrplandaten werden innerhalb eines SoS-Frameworks koordiniert, um Staus zu vermeiden und Stromnetzbelastungen zu optimieren. Damit wird nicht nur Energie effizienter genutzt, sondern auch die Umweltbelastung durch Abgase und Lärm reduziert.
Gründe für urbane Priorisierung
Die starke Gewichtung von Smart Cities und Smart Grids in der SoS-Forschung lässt sich durch mehrere Faktoren erklären. Erstens verfügen städtische Infrastrukturen über die notwendige digitale Basis: Sensoren, IoT-Geräte und Cloud-Plattformen sind in Städten wesentlich häufiger verfügbar als in ländlichen Regionen. Zweitens besteht politischer und wirtschaftlicher Druck, urbane Lebensräume nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Drittens erlauben Städte aufgrund ihrer Dichte und Heterogenität eine schnellere Skalierung von Systemlösungen. Durch diese Kombination aus technischen, sozialen und politischen Treibern entwickeln sich urbane SoS-Projekte besonders dynamisch.
Kritische Bewertung des Schwerpunkts
Obwohl urbane Systeme eine logische Priorität darstellen, kritisiert die Studie die einseitige Ausrichtung der bisherigen Forschung. Smart Cities und Smart Grids lösen vor allem die Probleme wohlhabender, gut vernetzter Metropolen. Die globalen Umweltprobleme betreffen jedoch ebenso stark ländliche Regionen, Schwellenländer und natürliche Ökosysteme. Die Fokussierung auf urbane High-Tech-Lösungen birgt die Gefahr, andere wichtige Felder zu vernachlässigen und strukturelle Ungleichheiten zu verschärfen. Nachhaltige Entwicklung erfordert einen breiteren Anwendungsrahmen für Systems-of-Systems, der auch außerhalb der Städte funktioniert.
Technologische Implikationen für Forschung und Entwicklung
Der Fokus auf urbane Systeme hat methodische Folgen für die technische Forschung. Viele SoS-Modelle basieren auf cloudbasierten Plattformarchitekturen, Blockchain-Anwendungen und Machine-Learning-Algorithmen zur Mustererkennung und Steuerung. Diese Technologien sind stark auf Datenverfügbarkeit und Interoperabilität angewiesen. Die Übertragbarkeit auf andere Bereiche wird dadurch erschwert, weil dort oft weder die Datenmengen noch die Kommunikationsinfrastruktur vorhanden sind. Die Autoren der Kartierungsstudie empfehlen daher, verstärkt an schlanken, resilienten SoS-Architekturen zu arbeiten, die auch in datenarmen oder instabilen Umgebungen zuverlässig funktionieren.

Unterrepräsentierte Anwendungsfelder: Landwirtschaft und Waldschutz
Systemische Nachhaltigkeit braucht mehr als urbane Lösungen
Obwohl Smart Cities und Smart Grids das Zentrum aktueller Systems-of-Systems-Forschung darstellen, zeigen die Daten der Kartierungsstudie eine deutliche Vernachlässigung nicht-urbaner Anwendungsfelder. Nachhaltige Landwirtschaft, Waldschutz und Biodiversitätsmanagement finden sich in weniger als 15 Prozent der analysierten Studien. Dieser Befund ist besonders kritisch, da diese Bereiche global betrachtet mindestens ebenso bedeutend für Umwelt- und Klimaziele sind wie städtische Systeme. Landwirtschaft und Forstwirtschaft prägen riesige Flächenanteile der Erde und stehen im Zentrum von Fragen zu Ernährungssicherheit, CO₂-Speicherung und Artenschutz.
Landwirtschaft als komplexes System mit SoS-Potenzial
Moderne Landwirtschaft ist längst nicht mehr nur ein lokales Produktionssystem, sondern Teil globaler Lieferketten, Wetterabhängigkeit und ökologischer Regulation. Aus Systems-of-Systems-Perspektive umfasst nachhaltige Landwirtschaft mindestens fünf Subsysteme: Bodennutzung, Wasserbewirtschaftung, Pflanzenschutz, Erntelogistik und Energiemanagement. Diese Systeme sind miteinander verbunden, agieren jedoch weitgehend unkoordiniert. In der Praxis zeigt sich, dass digitale Lösungen für Smart Farming meist Insellösungen sind, etwa einzelne Sensorik-Anwendungen oder GPS-gesteuerte Traktoren. Eine systematische Integration all dieser Elemente zu einem übergreifenden SoS-Framework existiert bislang nur in Ansätzen.
Beispiele für integrierte Landwirtschaftssysteme
Die Kartierung identifizierte wenige Studien, die sich explizit mit SoS-Ansätzen in der Landwirtschaft befassen. Besonders erwähnt werden Projekte aus Australien und Kanada, die regionale Agrarsysteme mit Wasser- und Energiemanagement koppeln. Dabei werden Bewässerungssysteme, Wetterstationen, Düngemittelmanagement und Erntevorhersage in einem gemeinsamen Datenframework verbunden. Diese Ansätze zeigen das Potenzial, Ressourceneffizienz zu steigern und gleichzeitig Umweltbelastungen zu senken. Jedoch bleibt der Skalierungseffekt bislang begrenzt, da solche Systeme hohe technische Anforderungen stellen und oft auf Großbetriebe beschränkt sind.
Waldschutz und Biodiversitätsmanagement als Leerstelle
Noch deutlicher ist die Forschungslücke im Bereich Waldschutz und Biodiversität. In der Kartierung fanden sich nur einzelne Studien, die sich mit systemischen Ansätzen zur Integration von Waldbrandprävention, Habitatüberwachung und Holzbewirtschaftung beschäftigen. Dabei bieten Wälder ein enormes Potenzial für Systems-of-Systems-Strukturen. Sensoriknetze zur Brandfrüherkennung, Drohnentechnologie für Artenschutzmonitoring, CO₂-Speicherverwaltung und nachhaltige Holznutzung könnten als verbundene Systeme orchestriert werden. Derzeit beschränken sich viele Technologien auf Einzelanwendungen ohne Integration in ein Gesamtframework.
Gründe für die Vernachlässigung
Die Autoren der Studie identifizieren mehrere Gründe für diese systematische Vernachlässigung. Erstens sind Dateninfrastrukturen außerhalb urbaner Räume schwach ausgebaut, was die Erhebung und Vernetzung relevanter Informationen erschwert. Zweitens fehlen oft institutionelle Strukturen, die eine systemübergreifende Koordination gewährleisten könnten. Drittens sind wirtschaftliche Anreize ungleich verteilt: Während Smart-City-Projekte öffentlich gefördert und von privaten Unternehmen vorangetrieben werden, fehlt diese Dynamik im landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Sektor. Auch der politische Fokus auf urbane Nachhaltigkeitsthemen trägt zur Forschungslücke bei.
Folgen für globale Nachhaltigkeitsziele
Die einseitige Konzentration auf urbane Systeme gefährdet die Erreichung übergreifender Nachhaltigkeitsziele. Landwirtschaft und Waldschutz sind zentrale Elemente der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, etwa für Ernährungssicherheit, Klimaresilienz und Artenschutz. Ohne systemische Ansätze in diesen Bereichen bleiben große Potenziale ungenutzt. So könnten etwa Smart-Farming-SoS Wasserverbrauch in der Landwirtschaft um bis zu 30 Prozent reduzieren oder Waldbrandrisiken systematisch früher erkennen. Die Studie plädiert daher für eine gezielte Ausweitung der Forschung und Förderung im Bereich ländlicher und ökologischer SoS-Anwendungen.
Technologische und organisatorische Lösungsansätze
Um diese Lücken zu schließen, schlagen die Autoren mehrere Lösungsstrategien vor. Dazu gehören die Entwicklung dezentraler, leicht skalierbarer SoS-Architekturen für datenarme Regionen sowie der Aufbau übergreifender Governance-Strukturen, die Systemintegration auch außerhalb städtischer Kontexte ermöglichen. Besonders betont wird der Bedarf an offenen Datenstandards und interoperablen Schnittstellen, um fragmentierte Einzellösungen zusammenzuführen. Zusätzlich sollte die Rolle öffentlicher Institutionen bei der Koordination und Finanzierung solcher Projekte gestärkt werden, da Marktmechanismen allein nicht ausreichen, um komplexe Umwelt-SoS in diesen Bereichen voranzubringen.

Technische Herausforderungen: Interoperabilität und Skalierbarkeit
Systems-of-Systems erfordern mehr als Datenvernetzung
Die Zusammenführung mehrerer Subsysteme zu einem übergeordneten Umwelt-System-of-Systems stellt hohe technische Anforderungen, die über klassische IT-Fragen hinausgehen. Die Kartierungsstudie identifiziert Interoperabilität und Skalierbarkeit als zwei der wichtigsten technischen Engpässe. Interoperabilität bedeutet, dass unterschiedliche Systeme, Geräte und Plattformen miteinander kommunizieren und Daten austauschen können, auch wenn sie ursprünglich nicht füreinander entwickelt wurden. Skalierbarkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, bei steigender Größe oder wachsendem Datenvolumen zuverlässig zu funktionieren, ohne dass Effizienz oder Stabilität verloren gehen.
Datenformate und Schnittstellen als zentrales Problem
Die Untersuchung zeigt, dass Umwelt-SoS-Projekte häufig an inkompatiblen Datenformaten scheitern. Smart Grids nutzen andere Protokolle als Verkehrssysteme, Sensorennetzwerke sprechen nicht dieselbe Sprache wie landwirtschaftliche Plattformen. Besonders problematisch ist dies, weil viele Umweltanwendungen von unterschiedlichen Akteuren betrieben werden: Energieversorger, kommunale Verwaltungen, private Landwirte oder NGOs verwenden jeweils eigene Softwarelösungen. Ohne standardisierte Schnittstellen bleibt der Datenaustausch aufwändig und fehleranfällig. Die Studie betont daher die Notwendigkeit international verbindlicher Datenstandards und offener APIs, damit SoS-Integration nicht an technischen Details scheitert.
Skalierungsprobleme bei großen Systemverbünden
Während kleine Pilotprojekte oft funktionieren, zeigen sich bei der Übertragung auf größere geografische Räume oder höhere Systemanzahl massive technische Herausforderungen. Beispielsweise wächst bei wachsenden Netzwerken die Anzahl der Verbindungen exponentiell, was zu Lastproblemen in der Datenverarbeitung führt. Die Kartierung zeigt, dass viele SoS-Architekturen bisher nicht für nationale oder gar globale Skalierung ausgelegt sind. Besonders kritische Punkte sind Datenlatenz, Rechenkapazität und Netzwerksicherheit. Dezentrale Steuerungsmodelle, etwa über verteilte Cloud-Infrastrukturen oder Blockchain-Technologie, gelten daher als bevorzugte Lösungsansätze, bringen aber ebenfalls neuen Koordinationsaufwand mit sich.
Echtzeitfähigkeit und Reaktionszeiten
Viele Umwelt-SoS-Anwendungen erfordern Echtzeitreaktionen, etwa bei der Steuerung von Stromnetzen, der Überwachung von Luftqualität oder der Waldbrandfrüherkennung. Die Studie weist darauf hin, dass gerade hier technische Engpässe entstehen, wenn Daten aus verschiedenen Subsystemen erst zusammengeführt, geprüft und interpretiert werden müssen, bevor eine Entscheidung ausgelöst werden kann. Latenzen von mehreren Sekunden oder Minuten können in kritischen Situationen erhebliche Folgen haben. Besonders in komplexen Systemen mit heterogener Hard- und Software-Infrastruktur erfordert die Sicherstellung von Echtzeitfähigkeit aufwendige technische Lösungen, etwa durch Edge Computing und Priorisierung von Datenströmen.
Sicherheit und Datenschutz als technologische Daueraufgaben
Mit wachsender Vernetzung steigt auch das Risiko von Angriffen und Datenmissbrauch. Umwelt-SoS-Systeme verarbeiten häufig sensible Daten: von individuellen Verbrauchsprofilen bis hin zu kritischen Infrastrukturdaten. Die Kartierungsstudie identifiziert Cybersicherheit als ein zentrales technisches Querschnittsthema, das bislang oft unzureichend adressiert wird. Insbesondere in heterogenen Systemlandschaften besteht die Gefahr von Sicherheitslücken an den Übergängen zwischen Teilsystemen. Lösungen wie Zero-Trust-Architekturen, verschlüsselte Kommunikationsprotokolle und mehrstufige Authentifizierungsmodelle werden daher als unverzichtbar für den zuverlässigen Betrieb großflächiger Umwelt-SoS bewertet.
Technische Standardisierung als Schlüsselstrategie
Die Studie empfiehlt dringend, Standardisierungsprozesse auf internationaler Ebene zu forcieren. Initiativen wie IEEE oder ISO arbeiten bereits an entsprechenden Normen, jedoch ohne flächendeckende Implementierung. Offene Architekturen, modulare Bauweise und gemeinsame Protokolle sind notwendig, damit verschiedene Anbieter, Behörden und zivilgesellschaftliche Organisationen SoS-Komponenten austauschen und kombinieren können. Besonders betont wird dabei der Ansatz der offenen Plattformökonomie, bei der proprietäre Systeme zugunsten gemeinsamer Infrastrukturen zurücktreten. Diese Strategie gilt als essenziell, um Innovation zu fördern und gleichzeitig Interoperabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
Langfristige Forschungsbedarfe und Entwicklungsziele
Trotz bereits existierender technischer Lösungen sieht die Kartierung erheblichen Forschungsbedarf. Besonders wichtig sind robuste, selbstheilende Systeme, die auch bei Teilausfällen funktionstüchtig bleiben, sogenannte resilience-by-design-Architekturen. Auch die Entwicklung KI-gestützter Steuerungsmodelle, die nicht nur Einzelwerte, sondern ganze Systemlandschaften in Echtzeit analysieren und optimieren, wird als Zukunftsfeld genannt. Schließlich betonen die Autoren die Bedeutung energiesparender Technologien: Denn selbst Systeme, die Nachhaltigkeit fördern sollen, verursachen durch ihren Betrieb wiederum Umweltbelastungen. Green IT wird daher als integraler Bestandteil zukünftiger Umwelt-SoS-Systeme betrachtet.

Sozio-technische Barrieren und Datenverwaltung
Umwelt-SoS funktionieren nicht ohne organisatorische Strukturen
Neben technischen Hürden sind es vor allem institutionelle und soziale Barrieren, die Systems-of-Systems im Umweltbereich einschränken. Die Kartierungsstudie zeigt deutlich: Ohne klare Governance-Modelle, rechtliche Rahmenbedingungen und abgestimmte Verantwortlichkeiten bleibt die Integration komplexer Umweltsysteme Stückwerk. Besonders auffällig ist die Fragmentierung zwischen öffentlichen und privaten Akteuren. Energieunternehmen, Stadtverwaltungen, Landwirte und Umweltbehörden verfügen über jeweils eigene Interessen, Datenformate und Abläufe. Diese institutionelle Zersplitterung behindert den Aufbau gemeinsamer Systemlandschaften und reduziert die Wirksamkeit selbst technisch ausgereifter Lösungen.
Vertraulichkeit und Datenschutz als strukturelles Hemmnis
Umwelt-SoS verarbeiten zwangsläufig große Mengen personenbezogener und betriebskritischer Daten. In Smart-City-Projekten etwa erfassen Sensoren Bewegungsprofile und Energieverbrauch auf Gebäudeebene. In der Landwirtschaft entstehen Daten zu Anbauflächen, Erträgen und Nutzungszyklen. Die Kartierung zeigt, dass viele Akteure aus Sorge vor Datenmissbrauch oder wirtschaftlichem Nachteil nur begrenzt bereit sind, Informationen in offene Plattformen einzuspeisen. Besonders kleine und mittlere Unternehmen, aber auch Kommunen ohne eigene Datenschutzabteilungen zeigen hier hohe Zurückhaltung. Solange keine einheitlichen Datenschutzmodelle existieren, wird der Aufbau vertrauenswürdiger SoS-Strukturen erschwert.
Fehlende Anreizstrukturen für Datenfreigabe
Neben rechtlichen Fragen identifiziert die Studie auch ökonomische Barrieren. Viele Umwelt-SoS benötigen die Zusammenarbeit konkurrierender Organisationen. Gerade in marktwirtschaftlichen Systemen besteht wenig Anreiz, Daten zu teilen, wenn daraus kein direkter finanzieller Vorteil resultiert. Das gilt beispielsweise für Verkehrsunternehmen, die ihre Auslastungsdaten nicht mit Wettbewerbern teilen möchten, oder landwirtschaftliche Betriebe, die Ertragsdaten als Geschäftsgeheimnis betrachten. Diese Blockade lässt sich nach Einschätzung der Autoren nur durch gezielte politische Anreize aufbrechen, etwa durch Förderprogramme, die Datenfreigabe zur Voraussetzung machen.
Governance-Modelle und Verantwortungsverteilung
Ein weiterer kritischer Punkt betrifft die Frage, wer für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung von Umwelt-SoS verantwortlich ist. Die Kartierungsstudie macht deutlich, dass bisher häufig unklare oder ineffektive Governance-Strukturen bestehen. In vielen Fällen sind mehrere Behörden und Unternehmen parallel zuständig, ohne dass Koordination oder einheitliche Entscheidungswege etabliert sind. Besonders in Krisensituationen, etwa bei Blackouts oder Umweltkatastrophen, führt dies zu ineffizienter Ressourcenverteilung und Verzögerungen. Die Autoren empfehlen daher, klare Zuständigkeiten festzulegen und zentrale Koordinierungsstellen einzurichten, die alle beteiligten Systeme zusammenführen.
Soziale Akzeptanz und Partizipation
Selbst technisch und organisatorisch funktionierende SoS-Systeme stoßen auf gesellschaftliche Akzeptanzgrenzen. Die Studie zeigt, dass Bürgerinnen und Bürger SoS-Initiativen häufig als intransparent oder bevormundend wahrnehmen. Besonders kritisch beurteilt wird der Eindruck permanenter Überwachung, etwa durch Sensoriknetze in Städten. Diese Skepsis ist nicht nur ein psychologisches Phänomen, sondern beeinflusst auch die tatsächliche Datennutzung, etwa wenn Menschen bewusst Systeme meiden, die Daten sammeln. Um solche Effekte zu vermeiden, empfehlen die Autoren transparente Kommunikationsstrategien und partizipative Strukturen, die Nutzer aktiv in die Gestaltung und Steuerung einbinden.
Datenqualität und Verlässlichkeit
Neben der Frage, ob Daten verfügbar sind, spielt auch deren Qualität eine entscheidende Rolle. Umwelt-SoS sind auf verlässliche, konsistente und aktuelle Daten angewiesen. Die Kartierung identifiziert hier ebenfalls Defizite, insbesondere bei Open-Data-Quellen oder freiwillig gemeldeten Informationen. Ungenaue Sensorwerte, veraltete Datensätze und fehlende Metadaten führen dazu, dass Systeme ineffektiv oder sogar kontraproduktiv arbeiten. Die Autoren fordern daher einheitliche Qualitätsstandards und Prüfmechanismen, um sicherzustellen, dass nur geprüfte Daten in Systemverbünden verwendet werden. Dies gilt besonders für sicherheitskritische Anwendungen wie Energieversorgung oder Katastrophenmanagement.
Politische und regulatorische Rahmenbedingungen
Abschließend zeigt die Kartierung, dass viele der identifizierten Probleme nur durch politische Steuerung lösbar sind. Es braucht verbindliche gesetzliche Vorgaben zu Datenfreigabe, Datenschutz und Systemverantwortung. Gleichzeitig müssen Förderprogramme nicht nur technologische Innovationen, sondern auch organisatorische Strukturen unterstützen. Besonders hervorgehoben wird die Bedeutung internationaler Harmonisierung, da Umwelt-SoS häufig über Ländergrenzen hinweg operieren. Die Autoren schlagen vor, bestehende Rahmenwerke wie die Sustainable Development Goals oder den European Green Deal gezielt um SoS-spezifische Elemente zu ergänzen und damit einen verbindlichen Ordnungsrahmen zu schaffen.

Zukünftige Forschungsperspektiven für Systems-of-Systems in der Umweltforschung
Erweiterung auf bislang vernachlässigte Bereiche
Die Kartierungsstudie zeigt eindeutig, dass Umwelt-Systems-of-Systems sich bisher stark auf urbane Anwendungen konzentrieren. Künftige Forschung sollte diesen Fokus systematisch erweitern. Besonders landwirtschaftliche Systeme, Schutz natürlicher Ressourcen und Klimaanpassungsmaßnahmen in ländlichen Regionen bieten großes Potenzial für SoS-Integration. Dazu gehören unter anderem datengetriebene Frühwarnsysteme für extreme Wetterereignisse, CO₂-Speicherüberwachung in Moor- und Waldgebieten oder die systemische Optimierung von Wasser- und Bodenressourcen. Die Autoren empfehlen deshalb Forschungsförderung mit spezifischem Schwerpunkt auf ruralen und ökologischen SoS-Strukturen.
Entwicklung flexibler und modularer SoS-Architekturen
Ein wesentliches Ziel zukünftiger Forschung besteht darin, modular aufgebaute SoS-Modelle zu entwickeln, die sich an unterschiedliche technische und organisatorische Gegebenheiten anpassen lassen. Solche Modelle müssten in der Lage sein, sowohl in hochvernetzten Smart Cities als auch in infrastrukturschwachen Regionen zuverlässig zu funktionieren. Besonders gefragt sind sogenannte plug-and-play-fähige Module, die ohne umfangreiche technische Anpassungen in bestehende Systeme integriert werden können. Diese Flexibilität wird entscheidend sein, um Systems-of-Systems flächendeckend nutzbar zu machen.
Integration von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen
Die Kartierung zeigt, dass viele der untersuchten Systeme noch stark regelbasiert arbeiten. Zukünftige SoS werden zunehmend auf adaptive, lernende Algorithmen setzen müssen. Künstliche Intelligenz kann helfen, komplexe Systeminteraktionen in Echtzeit zu analysieren und Entscheidungen autonom zu treffen. Besonders wichtig sind dabei Anwendungen im Bereich Predictive Maintenance, also der vorausschauenden Instandhaltung von Systemen, sowie adaptive Steuerung bei unvorhersehbaren Ereignissen wie Naturkatastrophen oder Marktveränderungen. KI-gestützte SoS-Modelle bieten damit nicht nur Effizienzsteigerungen, sondern auch mehr Resilienz gegenüber Störungen.
Fokus auf Resilienz und Krisenfähigkeit
Künftige Forschung sollte sich verstärkt der Frage widmen, wie Umwelt-SoS auch unter Extrembedingungen funktionieren können. Der Klimawandel wird die Zahl und Intensität von Krisensituationen weiter erhöhen. Systems-of-Systems müssen darauf vorbereitet sein, flexibel auf Stromausfälle, Netzunterbrechungen oder Datenverlust zu reagieren. Resilienzforschung im Kontext von SoS erfordert daher nicht nur technische Innovationen, sondern auch neue Organisationsmodelle, die Entscheidungsbefugnisse dynamisch zwischen Systemkomponenten verlagern können. Besonders relevant ist diese Frage für sicherheitskritische Anwendungen wie Energie- oder Wasserversorgung.
Open-Source-Plattformen und internationale Kooperation
Um den Ausbau und die Weiterentwicklung von Umwelt-SoS zu beschleunigen, plädieren die Autoren für eine stärkere Nutzung offener Software- und Datenplattformen. Open-Source-Modelle bieten den Vorteil, dass sie von einer Vielzahl von Akteuren weiterentwickelt und angepasst werden können. Gleichzeitig fördern sie internationale Kooperation, weil Systeme nicht an spezifische Anbieter gebunden sind. Besonders wichtig wird dies bei transnationalen Umweltfragen wie Luftqualität, Wasserressourcenmanagement oder grenzüberschreitenden Biodiversitätsprojekten.

Fazit: Systems-of-Systems als Schlüssel zur nachhaltigen Umweltinnovation
Gesamtbewertung der Studienergebnisse
Die systematische Kartierung liefert ein umfassendes Bild der aktuellen Forschung zu Umwelt-Systems-of-Systems. Smart Cities und Smart Grids dominieren die Landschaft, während andere Bereiche wie Landwirtschaft und Biodiversität deutlich unterrepräsentiert sind. Technische und organisatorische Herausforderungen betreffen vor allem Interoperabilität, Skalierbarkeit und Governance-Strukturen. Trotz dieser Defizite zeigen die analysierten Projekte eindrücklich das Potenzial von SoS-Strukturen, komplexe Umweltprobleme systemisch und nachhaltig zu adressieren.
Systems-of-Systems als unverzichtbares Werkzeug
Um globale Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, reichen isolierte technologische Lösungen nicht aus. Systems-of-Systems bieten die notwendige Architektur, um Energie, Mobilität, Ressourcenmanagement und Naturschutz flexibel und dynamisch zu verknüpfen. Sie sind damit nicht nur ein technisches Konzept, sondern eine zentrale Voraussetzung für zukunftsfähige Umweltpolitik. Ihre Bedeutung wird mit dem Fortschreiten des Klimawandels und der Digitalisierung weiter zunehmen.
Handlungsbedarf für Forschung, Politik und Wirtschaft
Die Autoren der Kartierungsstudie formulieren klare Empfehlungen: Erstens müssen Fördermittel gezielt auf bislang vernachlässigte Bereiche wie Landwirtschaft und Waldschutz ausgerichtet werden. Zweitens bedarf es internationaler Standardisierung und rechtlicher Rahmenbedingungen, um Interoperabilität und Datenschutz sicherzustellen. Drittens sind Open-Source-Strategien und partizipative Organisationsformen zu fördern, damit Systems-of-Systems nicht nur technologische, sondern auch gesellschaftliche Akzeptanz finden.
Ausblick auf die nächsten Jahre
Die Weiterentwicklung von Umwelt-SoS wird entscheidend davon abhängen, ob es gelingt, technische Innovation, institutionelle Reformen und gesellschaftliche Beteiligung zu einer integrierten Strategie zu verbinden. Systems-of-Systems könnten dabei zum Leitmodell einer neuen Umweltgovernance werden, in der Flexibilität, Transparenz und Nachhaltigkeit nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern sich gegenseitig bedingen. Finden Sie hier die Quelle.



