Die Geschwindigkeit, mit der sich wissenschaftliche Erkenntnisse verbreiten, hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten dramatisch erhöht. Früher vergingen zwischen Annahme und Veröffentlichung eines Fachartikels Monate oder sogar Jahre. Heute erscheinen viele Arbeiten innerhalb weniger Tage online. Diese Beschleunigung verändert nicht nur den Zugang zu Wissen, sondern auch die Mechanismen, durch die es bewertet wird. Wissenschaftliche Qualität und wissenschaftliche Geschwindigkeit geraten in ein neues Spannungsverhältnis. Forscherinnen und Forscher konkurrieren nicht mehr nur um Erkenntnisse, sondern auch um Sichtbarkeit in Echtzeit.
Frühveröffentlichung als Normalzustand
Mit dem Aufkommen digitaler Publikationsplattformen entstand ein neues Format: die Frühveröffentlichung oder Early Access. Artikel werden online gestellt, bevor sie das endgültige Layout, die paginierte Ausgabe oder das vollständige Band eines Journals erreichen. Diese Praxis wurde ursprünglich entwickelt, um Ergebnisse schneller verfügbar zu machen, vor allem in dynamischen Disziplinen wie Medizin, Klimaforschung und Informatik. Was als pragmatische Lösung begann, ist heute zur Norm geworden. Doch die Transparenz über den tatsächlichen Publikationsstatus ist dabei verloren gegangen. Leserinnen sehen eine fertige Arbeit, auch wenn sie formell noch in Bearbeitung ist.
Beschleunigung und ihre Nebenwirkungen
Die Sofortverfügbarkeit wissenschaftlicher Texte hat den Fluss von Ideen zweifellos beschleunigt. Forschende können auf neue Daten reagieren, bevor sie in gedruckten Ausgaben erscheinen. Gleichzeitig erzeugt diese Beschleunigung neue Probleme. Wenn Artikel mehrfach in verschiedenen Stadien – als Preprint, Early Access und schließlich als finale Publikation – auftauchen, entstehen Unsicherheiten darüber, welche Version maßgeblich ist. Zitierungen beziehen sich häufig auf Vorabfassungen, die sich später ändern. So entstehen doppelte Einträge in Datenbanken, verzerrte Zitationsraten und uneinheitliche Statistiken. Das eigentliche Ziel, Wissen schneller zugänglich zu machen, wird damit teilweise ins Gegenteil verkehrt: Übersicht geht verloren.
Die Macht der Metadaten
In einer digitalisierten Wissenschaftslandschaft entscheiden Metadaten über Sichtbarkeit. Jede Publikation trägt unscheinbare, aber entscheidende Informationen – Publikationsdatum, DOI, Version, Datenverfügbarkeit. Diese Angaben bestimmen, wie Suchmaschinen und bibliografische Datenbanken Artikel einordnen. Doch gerade hier zeigen sich Schwächen. Unterschiedliche Systeme interpretieren dieselben Metadaten unterschiedlich. Ein Artikel, der bei einem Verlag als Early Access geführt wird, kann in einer Datenbank bereits als vollständig veröffentlicht erscheinen. Diese Diskrepanz ist mehr als eine technische Ungenauigkeit. Sie beeinflusst Rankings, Impact-Faktoren und die Wahrnehmung wissenschaftlicher Leistung.
Der ökonomische Druck hinter der Schnelligkeit
Die Beschleunigung der Publikationsprozesse ist nicht nur technologisch, sondern auch ökonomisch motiviert. In einem kompetitiven Wissenschaftssystem hängt Reputation oft von der Anzahl der Veröffentlichungen ab. Förderinstitutionen und Universitäten werten quantitative Kennzahlen aus, um Leistung zu beurteilen. Je schneller eine Arbeit erscheint, desto eher fließt sie in solche Bewertungen ein. Frühveröffentlichungen schaffen daher einen Vorteil in der Sichtbarkeit – aber auch ein Risiko für wissenschaftliche Integrität. Denn die Priorität verschiebt sich von Qualität zu Tempo. Publizieren wird zur Währung, und Early Access zur Beschleunigungsmaschine in einem Markt der Aufmerksamkeit.
Unsichtbare Grenzen zwischen Wissen und Rohfassung
Die Öffentlichkeit nimmt Online-Artikel oft als endgültige Forschung wahr. Kaum jemand differenziert zwischen einem Preprint, einem Early-Access-Beitrag und der finalen Version. Dabei können sich inhaltliche Unterschiede ergeben, etwa durch nachträgliche Korrekturen, neue Daten oder veränderte Interpretationen. Besonders problematisch ist das in sensiblen Bereichen wie Medizin oder Umweltwissenschaft, wo Entscheidungen auf noch nicht geprüften Ergebnissen basieren können. Die Digitalisierung hat den Filter zwischen Labor und Öffentlichkeit dünner gemacht. Der Fluss von Wissen ist unmittelbarer – aber auch anfälliger für Fehlinterpretationen.
Informationsüberfluss und algorithmische Bewertung
Je mehr Datenbanken Inhalte in Echtzeit erfassen, desto stärker übernehmen Algorithmen die Bewertung. Zitationszahlen, Altmetrics und Ranking-Systeme entscheiden, welche Artikel sichtbar werden. Doch diese Systeme sind nur so zuverlässig wie ihre Eingangsdaten. Wenn Publikationsphasen uneinheitlich registriert sind, verzerren sie die Berechnungen. Ein Artikel, der Monate früher als „veröffentlicht“ gilt, sammelt Zitationen, bevor andere überhaupt gelistet sind. So entsteht ein kumulativer Vorteil – ein algorithmischer Schneeballeffekt, der nicht wissenschaftliche Qualität, sondern technische Zeitstempel belohnt.
Geschwindigkeit als kulturelles Paradigma
Die Beschleunigung der Forschung ist Ausdruck einer breiteren kulturellen Entwicklung. Wissenschaft orientiert sich zunehmend an den Logiken digitaler Märkte, in denen Neuigkeit mehr zählt als Tiefe. Schnellere Zyklen bedeuten ständige Aktualität, aber auch weniger Zeit für Reflexion. Der Druck, permanent Neues zu liefern, verdrängt den Wert des Verstehens. Early Access ist daher nicht nur ein technisches, sondern ein kulturelles Phänomen – ein Spiegel der Ungeduld einer Gesellschaft, die Wissen konsumiert, bevor es gereift ist.
Zwischen Innovation und Instabilität
Die Herausforderung liegt im Gleichgewicht zwischen Offenheit und Verlässlichkeit. Frühveröffentlichungen sind ein Gewinn für den globalen Wissensaustausch, solange sie klar gekennzeichnet und korrekt indiziert sind. Doch ohne einheitliche Standards droht das Vertrauen in wissenschaftliche Information zu erodieren. Das Fundament der Wissenschaft – Nachvollziehbarkeit – wird unterminiert, wenn niemand weiß, welche Version eines Artikels gültig ist. Die Digitalisierung hat Forschung befreit, aber sie verlangt neue Regeln für Ordnung im Überfluss. Genau an diesem Punkt setzt die Arbeit von Yunu Zhu an. Sie untersucht, wie digitale Plattformen den Übergang von der Erkenntnis zum öffentlichen Wissen verwalten – und wo dabei Transparenz verloren geht.
Frühveröffentlichung als System der modernen Wissenschaft
Die Studie von Yunu Zhu beleuchtet ein Phänomen, das längst zum Herzschlag der wissenschaftlichen Kommunikation geworden ist: die Frühveröffentlichung. In nahezu allen Disziplinen erscheinen Artikel heute zunächst in einer digitalen Vorabversion, bevor sie als endgültig markiert werden. Dieses Verfahren wurde eingeführt, um Wartezeiten zwischen Annahme und Veröffentlichung zu verkürzen. Forschende können ihre Ergebnisse schneller teilen, und Verlage profitieren von gesteigerter Sichtbarkeit. Doch mit dem Übergang vom Print- zum Digitalzeitalter hat sich die Bedeutung von „veröffentlicht“ verschoben. Wann ein Artikel tatsächlich als Teil des wissenschaftlichen Archivs gilt, ist nicht mehr eindeutig.
Forschungsfrage und Zielsetzung
Yunu Zhu, Informationswissenschaftlerin mit Schwerpunkt Bibliometrie, stellte die Frage, wie verschiedene wissenschaftliche Datenbanken diese neuen Publikationsphasen erfassen. Ihre Untersuchung trägt den Titel An exploratory study on the publication stages of early access articles in different bibliographic databases und wurde 2025 in PLOS ONE veröffentlicht. Sie analysiert, wie Plattformen wie Web of Science, Scopus und Engineering Village mit dem Begriff „Early Access“ umgehen und welche Abweichungen dabei entstehen. Ziel war es, zu verstehen, wie aus demselben Artikel in unterschiedlichen Systemen verschiedene Veröffentlichungsdaten, Versionsbezeichnungen und Klassifikationen entstehen können.

Ausgangslage und Relevanz
Der Hintergrund dieser Untersuchung liegt in der Explosion digitaler Inhalte. Mehr als drei Millionen wissenschaftliche Arbeiten erscheinen jährlich weltweit, ein erheblicher Anteil davon zunächst online. Frühveröffentlichungen schaffen neue Chancen für offene Wissenschaft, aber auch neue Unsicherheiten für jene, die Forschung bewerten oder nachvollziehen wollen. Bibliografische Datenbanken bilden die Grundlage für Indikatoren wie Impact-Faktoren oder Zitationsanalysen. Wenn sie denselben Artikel unterschiedlich einordnen, verändern sich Rankings und Statistiken – und damit auch Förderentscheidungen und Karriereverläufe. Zhus Arbeit zielt darauf ab, diese unsichtbaren Verschiebungen messbar zu machen.
Auswahl der Datenquellen
Die Studie konzentrierte sich auf drei der einflussreichsten Systeme: Web of Science (Clarivate), Scopus (Elsevier) und Engineering Village (Elsevier/Compendex). Diese Plattformen bestimmen maßgeblich, welche Forschung weltweit sichtbar wird. Jede dieser Datenbanken verfügt über eigene Kriterien zur Indexierung und zum Zeitpunkt, ab dem ein Artikel als veröffentlicht gilt. Zhu untersuchte, wie dieselben Publikationen zwischen 2022 und 2024 in diesen Systemen auftauchten und ob sich ihre Statusangaben deckten. Dabei zeigte sich, dass identische Artikel mit unterschiedlichen Zeitstempeln, Bezeichnungen und Publikationsphasen versehen waren – ein Hinweis auf strukturelle Inkonsistenz im globalen Publikationssystem.
Methodischer Ansatz
Zhu verwendete eine quantitative Analyse von Metadatenfeldern. Für mehr als zwanzigtausend Early-Access-Artikel aus verschiedenen Disziplinen wurden Daten zu Veröffentlichungsdatum, DOI, Zeitschrift, Band, Heft, Seitenzahl und Statusbezeichnung gesammelt. Anschließend wurden die Angaben aus den drei Datenbanken miteinander verglichen. Zusätzlich analysierte sie, wie sich diese Unterschiede auf Zitationsmuster auswirkten. Wenn ein Artikel in Scopus sechs Monate früher als „final“ gilt als in Web of Science, erhält er in dieser Zeit bereits Zitierungen, die in anderen Systemen noch nicht zählen. Auf diese Weise entstehen Verzerrungen, die sich kumulativ verstärken.
Datenauswertung und Klassifikationslogik
Die Studie legte offen, dass es keine international einheitliche Definition für „Early Access“ gibt. Manche Verlage bezeichnen jeden online veröffentlichten Artikel vor der Paginierung so, andere verwenden den Begriff nur für akzeptierte Manuskripte ohne endgültiges Layout. Die Datenbanken übernehmen diese Informationen aus den Metadaten der Verlage, interpretieren sie aber unterschiedlich. Web of Science kennzeichnet Early-Access-Artikel mit einem eigenen Feld und ersetzt den Status später durch die finale Version. Scopus dagegen führt beide Einträge oft parallel. Engineering Village wiederum integriert Early Access unmittelbar in das reguläre Volumen, ohne Kennzeichnung. So entstehen systematische Widersprüche, die für Außenstehende kaum erkennbar sind.
Sichtbarkeit und Zitationsdynamik
Diese Inkonsistenzen wirken sich unmittelbar auf die Wahrnehmung wissenschaftlicher Relevanz aus. Artikel, die in einem System früher erscheinen, haben einen zeitlichen Vorsprung bei Zitationen und Downloadzahlen. Forscherinnen und Forscher, deren Arbeiten in Datenbanken schneller als „veröffentlicht“ gelten, profitieren von erhöhter Sichtbarkeit. Für die Bewertung wissenschaftlicher Leistung bedeutet das einen unfairen Vorteil. Gleichzeitig werden Publikationen, die in anderen Systemen noch als „in press“ geführt werden, statistisch unterschätzt. Zhu spricht von einer „Zitationsasymmetrie“, die aus technischer Uneinheitlichkeit entsteht, aber reale Karrieren beeinflusst.
Frühveröffentlichung und Vertrauensfragen
Neben den quantitativen Auswirkungen wirft die Untersuchung auch Fragen des Vertrauens auf. Wenn wissenschaftliche Datenbanken denselben Artikel unterschiedlich behandeln, untergräbt das die Glaubwürdigkeit ihrer Indikatoren. Forschende, Institutionen und Fördergeber verlassen sich auf diese Systeme, um Leistung zu messen. Doch wenn der Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht standardisiert ist, verliert das Zählen seine Aussagekraft. Der Begriff „veröffentlicht“ wird zu einer relativen Kategorie, abhängig davon, welche Plattform man betrachtet. Damit wird eine zentrale Säule moderner Wissenschaft – Nachvollziehbarkeit – stillschweigend aufgeweicht.
Bedeutung der Studie
Zhus Arbeit ist eine der ersten systematischen Analysen, die den Begriff Early Access nicht inhaltlich, sondern strukturell untersucht. Sie zeigt, dass die Infrastruktur der Wissenschaft selbst eine Quelle von Verzerrungen sein kann. Frühveröffentlichungen schaffen neue Formen der Sichtbarkeit, aber auch neue Formen der Unsichtbarkeit. Ihre Studie macht deutlich, dass offene Wissenschaft mehr braucht als freien Zugang: Sie benötigt kohärente Datenstandards. Nur wenn die Metadaten aller Systeme übereinstimmen, können Forschungsergebnisse fair verglichen und korrekt bewertet werden. Damit rückt eine unscheinbare, technische Ebene ins Zentrum der wissenschaftlichen Integrität – der Zeitpunkt, an dem Wissen offiziell existiert.
Aufbau der Untersuchung
Die Studie von Yunu Zhu wurde so konzipiert, dass sie den gesamten Publikationsprozess eines wissenschaftlichen Artikels datenbasiert abbildet. Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass die gleichen Arbeiten in verschiedenen Datenbanken zu unterschiedlichen Zeitpunkten als „veröffentlicht“ erscheinen. Um diese Diskrepanz systematisch zu erfassen, wählte Zhu eine große, interdisziplinäre Stichprobe aus. Sie analysierte Early-Access-Artikel aus Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik und Medizin, die zwischen Januar 2022 und September 2024 erstmals online erschienen. Dadurch ließ sich prüfen, ob Inkonsistenzen zufällig oder systematisch auftreten und ob bestimmte Fachgebiete stärker betroffen sind.
Datenerhebung und Stichprobenumfang
Die Auswahl umfasste über 20 000 Artikel, die über Digital Object Identifier (DOI) eindeutig identifiziert wurden. Mithilfe automatisierter Skripte wurden Metadaten aus drei der wichtigsten bibliografischen Systeme – Web of Science, Scopus und Engineering Village – abgerufen. Diese Plattformen decken den Großteil der weltweiten Forschungspublikationen ab und bilden zugleich die Grundlage für Zitationsanalysen und bibliometrische Kennzahlen. Jede Datenbank liefert Informationen über Erscheinungsdatum, Band, Heft, Seitenzahlen, Verlagsangaben und Publikationsstatus. Zhu verglich, ob diese Angaben für denselben DOI konsistent waren oder voneinander abwichen. Damit entstand ein Datensatz, der die inneren Strukturen der Publikationsinfrastruktur sichtbar machte.

Klassifikation der Publikationsphasen
Die zentrale Variable der Analyse war die sogenannte „Publication Stage“. Verlage unterscheiden typischerweise mehrere Stadien: „Accepted Manuscript“, „Early Access“ oder „Online First“, „In Press“ und „Final Published“. Zhu dokumentierte, wie diese Kategorien in den verschiedenen Datenbanken interpretiert wurden. Während Web of Science zwischen Early Access und finalem Artikel klar differenziert, führt Scopus oft beide Versionen gleichzeitig und vergibt unterschiedliche Zeitstempel. Engineering Village integriert die Vorabveröffentlichung direkt in das endgültige Volume, wodurch der Übergang unsichtbar wird. Diese Unterschiede sind nicht nur semantisch, sondern wirken sich auf die Sichtbarkeit und Zitationslogik aus. Ein Artikel, der zwei verschiedene Veröffentlichungsdaten trägt, kann in der wissenschaftlichen Wahrnehmung doppelt vorkommen.
Metadatenanalyse und technische Vorgehensweise
Zur Auswertung nutzte Zhu Methoden der Metadatenforensik. Für jeden Artikel wurden die Felder DOI, „First Online Date“, „Issue Date“, „Indexed Date“ und „Publication Stage“ extrahiert. Anschließend erfolgte ein Vergleich zwischen den Systemen auf Übereinstimmung. Abweichungen wurden nach Typ kategorisiert: zeitliche Differenz, Statusdifferenz oder doppelte Indexierung. Zusätzlich prüfte sie die Zuverlässigkeit der DOI-Auflösung über Crossref, um sicherzustellen, dass die Quelle eindeutig zugeordnet war. Der technische Aufwand war erheblich, da die Systeme unterschiedliche Schnittstellen verwenden und teilweise Daten nur begrenzt exportierbar sind. Die Analyse erforderte daher eine Kombination aus API-Abfragen, manuellem Abgleich und algorithmischer Normalisierung.
Qualitätskontrolle und Validierung
Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, wurden zufällig ausgewählte Datensätze manuell überprüft. Dabei zeigte sich, dass manche Unterschiede durch Verlagsverzögerungen erklärbar waren, die Mehrheit jedoch aus systeminternen Prozessen resultierte. Web of Science etwa aktualisiert den Publikationsstatus nachträglich, wenn ein Artikel in einer gedruckten Ausgabe erscheint. Scopus hingegen speichert den ursprünglichen Zeitstempel und überschreibt ihn nicht. Diese Abweichung führt dazu, dass derselbe Artikel je nach Plattform unterschiedlich alt erscheint. Zhu verifizierte die Plausibilität der Zeitdifferenzen, indem sie Veröffentlichungsdaten direkt auf den Websites der Zeitschriften überprüfte. Das Ergebnis bestätigte, dass die Inkonsistenz nicht aus menschlichem Fehler, sondern aus algorithmischen Unterschieden der Systeme entsteht.
Disziplinäre Unterschiede
Die Untersuchung zeigte, dass die Häufigkeit von Inkonsistenzen je nach Fachgebiet variiert. In den Natur- und Lebenswissenschaften war die Differenz zwischen Early Access und finaler Publikation im Durchschnitt größer als in den Geisteswissenschaften. Besonders stark betroffen waren medizinische und technische Journale, in denen schnelle Veröffentlichung politisch und wirtschaftlich relevant ist. Hier betrug der zeitliche Abstand zwischen Online-First und finalem Erscheinen oft mehr als sechs Monate. In den Sozialwissenschaften lag er meist unter drei Monaten. Diese Unterschiede verdeutlichen, dass sich der Druck zur Beschleunigung ungleich über das wissenschaftliche Feld verteilt. Frühveröffentlichungen sind dort am häufigsten, wo Konkurrenz um Aufmerksamkeit besonders groß ist.
Bibliometrische Berechnung und Verzerrungen
Zhu berechnete, wie sich unterschiedliche Indexierungszeitpunkte auf bibliometrische Kennzahlen auswirken. Dazu wurden Zitationszahlen innerhalb der ersten sechs Monate nach Erscheinen verglichen. Artikel, die in Scopus früher als final gelistet waren, erreichten bis zu 25 Prozent mehr Zitierungen als dieselben Artikel in Web of Science im gleichen Zeitraum. Dieser Vorsprung bleibt bestehen, weil die meisten Zitationsalgorithmen kumulativ arbeiten. Eine frühe Registrierung wird dadurch zum dauerhaften Vorteil. Die Studie belegt damit, dass die technische Ordnung wissenschaftlicher Datenbanken reale Auswirkungen auf Karriere- und Förderlogiken hat – ein Effekt, der bisher kaum thematisiert wurde.
Grenzen und methodische Reflexion
Zhu weist darauf hin, dass die Untersuchung explorativ ist und keine absolute Vollständigkeit beansprucht. Manche Verlage liefern Metadaten über proprietäre Schnittstellen, die nicht vollständig zugänglich sind. Auch regionale Unterschiede in den Indexierungsprozessen können das Bild verzerren. Dennoch erlaubt die große Stichprobe robuste Aussagen über Muster und Tendenzen. Die methodische Stärke liegt in der Parallelanalyse mehrerer Systeme, die sonst getrennt betrachtet werden. Durch diesen Ansatz wird sichtbar, dass bibliografische Datenbanken nicht neutral sind, sondern aktiv Strukturen wissenschaftlicher Wahrnehmung formen.
Implikationen für die Informationswissenschaft
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Informationssysteme selbst zum Forschungsobjekt werden müssen. Bibliometrische Analysen beruhen auf Vertrauen in technische Genauigkeit. Wenn diese Grundlage brüchig ist, verliert die Wissenschaft einen Teil ihrer Selbstreferenz. Zhus methodischer Ansatz zeigt, wie Informationswissenschaft über reine Datensammlung hinausgehen kann: Sie untersucht die Infrastruktur des Wissens als sozio-technisches System. Damit verschiebt sich die Aufmerksamkeit von der Bewertung wissenschaftlicher Inhalte auf die Mechanismen, die deren Sichtbarkeit überhaupt erst herstellen.
Schlussfolgerung des methodischen Teils
Die präzise Rekonstruktion der Publikationspfade macht deutlich, dass „Early Access“ kein neutraler Übergangsstatus ist, sondern ein eigenständiger Akteur im Kommunikationsprozess. Zwischen Annahme und finaler Veröffentlichung entstehen mehrere parallele Realitäten desselben Artikels. Diese Überlagerungen bleiben oft unbemerkt, beeinflussen aber Zitation, Rezeption und Vertrauen in wissenschaftliche Daten. Zhus Studie legt die methodische Grundlage, um diese unsichtbare Ebene zu quantifizieren. Damit schafft sie ein Werkzeug, das nicht nur Informationswissenschaft, sondern auch Wissenschaftspolitik neu ausrichten könnte – hin zu einer transparenten, nachvollziehbaren und fairen Publikationskultur.
Frühveröffentlichung als Quelle von Verzerrung
Die Ergebnisse der Studie von Yunu Zhu zeigen deutlich, dass Frühveröffentlichungen nicht nur ein logistisches Hilfsmittel sind, sondern ein System mit tiefgreifenden Konsequenzen. In den analysierten Datenbanken fanden sich Unterschiede von bis zu sechs Monaten zwischen dem Zeitpunkt, an dem ein Artikel erstmals online erschien, und jenem, an dem er als endgültig veröffentlicht galt. Diese Zeitspanne ist entscheidend, weil viele Zitationsmetriken genau an diesem Datum ansetzen. Je früher ein Artikel als „final“ klassifiziert wird, desto mehr Zeit hat er, Zitationen zu sammeln – unabhängig davon, ob sein Inhalt sich in der Zwischenzeit verändert. Frühveröffentlichungen erzeugen damit eine Art wissenschaftlichen Vorsprung, der nichts mit Erkenntnisgewinn, sondern mit Metadatenlogik zu tun hat.
Unschärfe der Publikationsgrenzen
Die Untersuchung legt offen, dass der Übergang zwischen Annahme, Online-Stellung und finaler Veröffentlichung unscharf geworden ist. Wo früher ein klarer Schnitt bestand – Manuskript eingereicht, geprüft, gedruckt –, existieren heute fließende Grenzen. Manche Verlage veröffentlichen akzeptierte Manuskripte unmittelbar nach der Begutachtung, andere erst nach Layout und Satz. Diese Vielfalt an Definitionen wird von den Datenbanken nicht harmonisiert. Das Ergebnis: derselbe Artikel kann gleichzeitig als „in press“ und als „published“ geführt werden. Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Publikationsdaten für Analysen oder Förderanträge verwenden, entsteht damit ein verzerrtes Bild der Forschungsaktivität.
Zitationsasymmetrien als Folge
Ein zentrales Ergebnis der Studie betrifft die sogenannte Zitationsasymmetrie. Artikel, die in einer Datenbank frühzeitig als veröffentlicht markiert sind, erhalten schneller Sichtbarkeit in automatisierten Suchsystemen und werden dadurch häufiger zitiert. Diese Zitationsvorteile bleiben dauerhaft bestehen, weil spätere Aktualisierungen den Zeitstempel nicht verändern. So entstehen im wissenschaftlichen Wettbewerb Unterschiede, die nicht auf Qualität, sondern auf technische Registrierung zurückgehen. Besonders betroffen sind Disziplinen mit hoher Publikationsfrequenz, etwa Medizin und Informatik. Hier kann ein halbes Jahr Vorsprung über Platzierungen in Ranglisten und Förderentscheidungen entscheiden. Zitationen, die Objektivität suggerieren, werden so zu einem Produkt der Systemarchitektur.
Fragmentierung des Wissensflusses
Die Diskrepanzen zwischen den Datenbanken führen zu einer Fragmentierung wissenschaftlicher Information. Forschende, die auf Web of Science basieren, sehen andere Veröffentlichungsstände als jene, die Scopus oder Engineering Village nutzen. Dadurch entstehen parallele Realitäten wissenschaftlicher Aktivität. Ein Artikel kann in einer Datenbank bereits stark zitiert erscheinen, während er in einer anderen noch nicht existiert. Diese Inkonsistenz erschwert Meta-Analysen, systematische Reviews und Trendprognosen, weil die zeitliche Grundlage unsicher wird. Zhu beschreibt dieses Phänomen als „zeitliche Divergenz wissenschaftlicher Kommunikation“ – ein Prozess, der das Vertrauen in Datenintegrität langfristig unterminiert.
Auswirkungen auf wissenschaftliche Bewertungssysteme
Publikationsdaten bilden die Grundlage zahlreicher Evaluationsmechanismen: Impact-Faktoren, H-Index, institutionelle Rankings. Wenn ihre Basisdaten uneinheitlich sind, verlieren diese Kennzahlen ihre Objektivität. Eine Universität, deren Forschende in Datenbanken mit früher Indexierung vertreten sind, erscheint produktiver, obwohl sie lediglich von Systemeffekten profitiert. Fördergeber, die auf Zitationszahlen setzen, bewerten damit nicht nur wissenschaftliche Leistung, sondern auch technische Sichtbarkeit. Die Studie zeigt, dass diese Diskrepanz inzwischen messbare Auswirkungen auf Ressourcenverteilung und Karrierewege hat. Wissenschaftliche Bewertung, einst als Spiegel der Erkenntnis gedacht, wird zum Spiegel der Datenarchitektur.
Frühveröffentlichungen und Open Science
Zhu ordnet ihre Ergebnisse in den größeren Kontext der Open-Science-Bewegung ein. Frühveröffentlichungen sollten ursprünglich die Zugänglichkeit von Wissen verbessern, indem sie Forschung sofort frei verfügbar machen. In der Praxis entsteht jedoch ein Paradoxon: Offenheit ohne Standardisierung führt zu Intransparenz. Leserinnen können nicht erkennen, ob sie eine vorläufige oder finale Version lesen. Open Access wird dadurch zum zweischneidigen Schwert – es demokratisiert Information, aber es verwischt zugleich die Grenzen der Verlässlichkeit. Die Studie plädiert daher nicht gegen Frühveröffentlichungen, sondern für deren einheitliche Kennzeichnung und Nachverfolgbarkeit über eindeutige Metadatenfelder.
Technische Ursachen der Diskrepanz
Die Ursachen für die Unterschiede liegen tief in der Architektur der Datenbanken. Web of Science bezieht seine Daten direkt von Verlagen, aktualisiert aber Publikationsstände manuell, wenn eine finale Version erscheint. Scopus dagegen führt beide Versionen parallel, um Kontinuität zu wahren, und entfernt alte Einträge nur bei expliziter Mitteilung des Verlags. Engineering Village integriert Early Access unmittelbar in das endgültige Volume, wodurch der Übergang unsichtbar wird. Diese divergierenden Strategien sind Folge historisch gewachsener Systeme, die nie für die gegenwärtige Geschwindigkeit wissenschaftlicher Publikation entwickelt wurden. Das Fehlen eines zentralen, verbindlichen Standards macht diese Inkonsistenzen unvermeidlich.
Folgen für Datenintegrität und Nachvollziehbarkeit
In einer Zeit, in der Forschung zunehmend datengetrieben ist, gewinnt der Begriff „Datenintegrität“ neue Bedeutung. Wissenschaftliche Aussagen beruhen nicht nur auf Ergebnissen, sondern auch auf präziser Dokumentation ihres Ursprungs. Wenn der Publikationszeitpunkt unklar ist, verlieren Zitationsketten ihre Chronologie. Das erschwert die Nachverfolgung von Ideen und die Rekonstruktion wissenschaftlicher Entwicklung. Frühveröffentlichungen können dadurch historische Spuren verwischen: Wer war zuerst, wer folgte? Die Studie zeigt, dass diese Unsicherheit selbst in hochstrukturierten Feldern wie Ingenieurwissenschaft oder Medizin messbar ist. Wissenschaft, die auf Präzision angewiesen ist, läuft Gefahr, ihre eigene Chronologie zu verlieren.

Auswirkungen auf automatisierte Forschungsauswertung
Künstliche Intelligenz und algorithmische Tools greifen zunehmend auf bibliografische Daten zu, um Trends zu erkennen oder Forschungsleistungen zu bewerten. Diese Systeme interpretieren Zeitstempel und Statusangaben wörtlich. Wenn sie fehlerhafte oder inkonsistente Daten verarbeiten, reproduzieren sie systemische Verzerrungen im großen Maßstab. Frühveröffentlichungen, die in einer Datenbank doppelt gezählt werden, führen zu verfälschten Netzwerkanalysen, überbewerteten Forschungsclustern und falschen Prognosen über wissenschaftliche Dynamik. Zhu weist darauf hin, dass KI-gestützte Wissenschaftsanalysen nur so zuverlässig sind wie die Daten, aus denen sie gespeist werden. Frühveröffentlichung wird so zu einem Testfall für die Glaubwürdigkeit datengetriebener Wissenschaft.
Zwischen Transparenz und Beschleunigung
Zhus Befunde legen ein Dilemma offen, das die moderne Forschung durchzieht. Einerseits verlangt die Gesellschaft nach schnelleren Erkenntnissen, andererseits nach Transparenz und Reproduzierbarkeit. Frühveröffentlichungen erfüllen das erste, gefährden aber das zweite Ziel. Geschwindigkeit ersetzt nicht Genauigkeit; sie verändert ihre Definition. Das Spannungsfeld zwischen beidem wird in Zukunft bestimmen, wie Wissenschaft organisiert ist. Die Studie zeigt, dass das Problem nicht in der Technologie selbst liegt, sondern in der fehlenden Koordination zwischen Akteuren – Verlagen, Datenbankbetreibern und Forschenden. Ohne gemeinsame Standards droht der Fortschritt der Kommunikation zur Quelle neuer Unübersichtlichkeit zu werden.
Unsichtbare Mechanismen der Sichtbarkeit
Die Analyse von Yunu Zhu zeigt, dass die Sichtbarkeit wissenschaftlicher Arbeiten längst nicht mehr allein vom Inhalt abhängt, sondern von den Mechanismen der digitalen Infrastruktur. Ob ein Artikel früh oder spät in einer Datenbank aufscheint, entscheidet darüber, wie schnell er zitiert, geteilt und in Bewertungsmetriken einbezogen wird. Dieser Prozess verläuft automatisiert und entzieht sich meist der Kontrolle der Forschenden. Frühveröffentlichungen wirken dabei wie Beschleuniger innerhalb eines Systems, das Geschwindigkeit belohnt. Sie verlängern die Lebensdauer eines Artikels in den Statistiken, indem sie eine Zeitspanne hinzufügen, die offiziell noch gar nicht begonnen haben sollte. Das Ergebnis ist ein stilles Wachstum der Sichtbarkeit – ein algorithmischer Vorteil ohne wissenschaftliche Ursache.
Frühzugriff als Wettbewerbsfaktor
In einer wissenschaftlichen Kultur, die durch Metriken und Rankings gesteuert wird, wird jede Form von zeitlichem Vorsprung zu Kapital. Forschungsinstitute und Autorinnen profitieren indirekt von der Frühindexierung ihrer Artikel, weil diese früher zählbar werden. Der Effekt summiert sich, wenn Förderprogramme und Berufungskommissionen quantitative Kennzahlen als objektive Messgrößen heranziehen. Frühveröffentlichungen schaffen somit ein unsichtbares Gefälle innerhalb der akademischen Konkurrenz. Diejenigen, deren Verlage oder Datenbanken schnell indexieren, sammeln Zitationen, bevor andere überhaupt erscheinen. Diese ungleiche Startlinie führt zu einer Verzerrung, die sich über Jahre fortsetzt. Zhu beschreibt dieses Phänomen als „temporal bias of visibility“ – ein Zeitvorteil, der mit wissenschaftlicher Qualität nichts zu tun hat.
Auswirkungen auf Vertrauen und Nachvollziehbarkeit
Der wissenschaftliche Diskurs lebt von der Möglichkeit, Entwicklungen nachzuvollziehen. Frühveröffentlichungen erschweren genau das. Wenn verschiedene Versionen desselben Artikels gleichzeitig im Umlauf sind, verschwimmen die Grenzen zwischen Vorabfassung und Endfassung. Ein Zitat, das sich auf eine Early-Access-Version bezieht, kann sich später auf Inhalte beziehen, die verändert oder ergänzt wurden. Der Rückverweis auf Quellen verliert damit an Präzision. Zhu weist darauf hin, dass dieser Effekt nicht trivial ist: In großen Forschungsnetzwerken können wenige unklare Zeitstempel ganze Argumentationsketten verfälschen. Der Verlust an Synchronität zwischen Text, Zitat und Veröffentlichung unterminiert die Chronologie des Wissens – die Grundlage wissenschaftlicher Logik.
Frühveröffentlichungen als Spiegel der Beschleunigungsgesellschaft
Die Dynamik, die Zhus Studie beschreibt, ist Ausdruck einer breiteren gesellschaftlichen Bewegung. Wissen zirkuliert heute unter denselben Bedingungen wie Nachrichten: schnell, flüchtig, permanent aktualisiert. In diesem Umfeld wird wissenschaftliche Publikation selbst zu einem Prozess der Echtzeit-Kommunikation. Das Tempo ersetzt die Substanz als Maßstab für Relevanz. Frühveröffentlichungen sind die wissenschaftliche Entsprechung von Breaking News – sie befriedigen das Bedürfnis nach Aktualität, aber nicht immer nach Verlässlichkeit. Die Beschleunigung der Publikation spiegelt damit den kulturellen Druck wider, ständig präsent zu sein. Wissenschaftliche Institutionen übernehmen unbewusst dieselben Rhythmen, die auch den digitalen Kapitalismus antreiben.
Algorithmische Verstärkung und Feedback-Schleifen
Zitationsmetriken und Ranking-Algorithmen reagieren empfindlich auf die Reihenfolge von Publikationen. Ein Artikel, der früher indexiert ist, wird häufiger angezeigt, häufiger zitiert und dadurch erneut sichtbarer – ein klassischer Verstärkungseffekt. Diese positive Rückkopplung verschiebt die Wahrnehmung wissenschaftlicher Qualität zugunsten derjenigen, die zuerst im System erscheinen. Zhu beschreibt dies als „autokatalytischen Prozess wissenschaftlicher Relevanz“. Er erinnert an ökonomische Netzwerke, in denen Aufmerksamkeit Reichtum erzeugt und Reichtum wiederum Aufmerksamkeit. Wissenschaftliche Popularität entsteht damit nicht nur aus Substanz, sondern aus Timing. Die Frühveröffentlichung wird zum Startsignal in einem Wettbewerb, den Algorithmen steuern.
Konsequenzen für Nachwuchsforschende
Besonders junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler spüren die Folgen dieser Entwicklung. In einem System, das auf messbare Leistung setzt, werden sie gezwungen, ihre Forschung möglichst schnell in sichtbare Publikationen zu überführen. Die Qualitätssicherung leidet, während das Risiko steigt, unfertige Ergebnisse zu publizieren. Frühveröffentlichung wird so zu einer institutionellen Erwartung. Wer zu langsam ist, verliert Förderchancen; wer zu schnell ist, riskiert Fehler. Dieses Spannungsfeld erzeugt eine neue Form von Druck, die Zhu als „temporal anxiety of publication“ beschreibt – die Angst, zu spät zu erscheinen. Damit verschiebt sich das Ideal wissenschaftlicher Arbeit von Genauigkeit zu Geschwindigkeit.
Frühveröffentlichung und wissenschaftliche Ethik
Die Untersuchung wirft auch ethische Fragen auf. Wenn Publikationszeitpunkte strategisch genutzt werden können, wird der Wettbewerb um Sichtbarkeit zu einer Grauzone. Manche Verlage fördern bewusst schnelle Online-Stellungen, um Zitationsraten und damit ihren Impact-Faktor zu erhöhen. Forschende wiederum profitieren davon, ohne aktiv zu manipulieren. Es entsteht eine stille Übereinkunft, bei der technische Vorteile als natürlicher Fortschritt erscheinen. Die Grenze zwischen legitimer Beschleunigung und systematischer Verzerrung verschwimmt. Zhu warnt davor, dass diese Entwicklung langfristig das Vertrauen in die Integrität bibliometrischer Systeme untergräbt – ein Risiko, das weit über Statistik hinausgeht.
Notwendigkeit standardisierter Datenstrukturen
Als Lösung identifiziert die Studie den Bedarf nach globalen Standards für Publikationsmetadaten. Plattformen wie Crossref, DataCite und ORCID könnten gemeinsame Zeitformate, Statusfelder und Validierungsmechanismen definieren, um Versionsverläufe eindeutig abzubilden. Eine international abgestimmte Metadatenarchitektur würde nicht nur Transparenz schaffen, sondern auch die Vergleichbarkeit von Zitationsdaten verbessern. Zhu argumentiert, dass offene Wissenschaft nur dann glaubwürdig bleibt, wenn ihre Datenstrukturen ebenso offen und überprüfbar sind wie ihre Inhalte. Frühveröffentlichung müsse ein klar definierter, nachvollziehbarer Zustand sein – kein Nebel aus technischen Zufällen.
Frühveröffentlichungen und die Zukunft der wissenschaftlichen Bewertung
Langfristig zwingt die Erkenntnis dieser Studie dazu, wissenschaftliche Bewertungssysteme neu zu denken. Kennzahlen wie Impact-Faktor oder H-Index beruhen auf der Annahme eines einheitlichen Veröffentlichungszeitpunkts. Diese Annahme ist im digitalen Zeitalter nicht mehr haltbar. Wenn Wissen fließend publiziert wird, müssen auch die Metriken fließender werden. Bewertungsmodelle könnten künftig nicht nur die Zahl der Zitationen, sondern deren zeitliche Dichte oder Stabilität berücksichtigen. Ein Artikel, der durch Frühveröffentlichung nur früher sichtbar wurde, sollte nicht denselben Einfluss repräsentieren wie einer, dessen Wirkung über Jahre konstant bleibt. Wissenschaft braucht neue Maße, die Zeitgerechtigkeit nicht mit Qualität verwechseln.
Frühveröffentlichung als Chance und Risiko
Zhus Untersuchung ist keine Anklage gegen Schnelligkeit, sondern ein Plädoyer für Bewusstsein. Frühveröffentlichungen können den Wissensaustausch revolutionieren, wenn sie transparent organisiert sind. Sie verkürzen den Weg von der Erkenntnis zur Anwendung und fördern Kooperation. Doch sie verlieren ihren Wert, wenn sie als taktisches Werkzeug in einem Wettbewerb der Zahlen genutzt werden. Die Studie zeigt, dass Wissenschaft ihre eigene Infrastruktur kritisch beobachten muss, um glaubwürdig zu bleiben. Geschwindigkeit ist nur dann Fortschritt, wenn sie von Klarheit begleitet wird. Frühveröffentlichung steht sinnbildlich für die Frage, wie viel Tempo Wahrheit verträgt.
Wege zu einer neuen Ordnung wissenschaftlicher Kommunikation
Die Untersuchung von Yunu Zhu endet mit einer klaren Diagnose: Frühveröffentlichungen sind ein Symptom einer Struktur, die schneller geworden ist, ohne sich neu zu organisieren. Das wissenschaftliche System hat Tempo aufgenommen, aber keine gemeinsamen Regeln geschaffen, um damit umzugehen. Wenn Sichtbarkeit und Bewertung von unkoordinierten Metadaten abhängen, verliert Wissenschaft ihre Objektivität. Der nächste Schritt liegt nicht in weiterer Beschleunigung, sondern in Standardisierung. Einheitliche Zeitformate, definierte Publikationsphasen und offene Datenprotokolle könnten die Unsicherheiten beseitigen, die Zhu sichtbar gemacht hat. Nur wenn Publikationsdaten übergreifend synchronisiert werden, kann digitale Wissenschaft so transparent bleiben, wie sie verspricht zu sein.
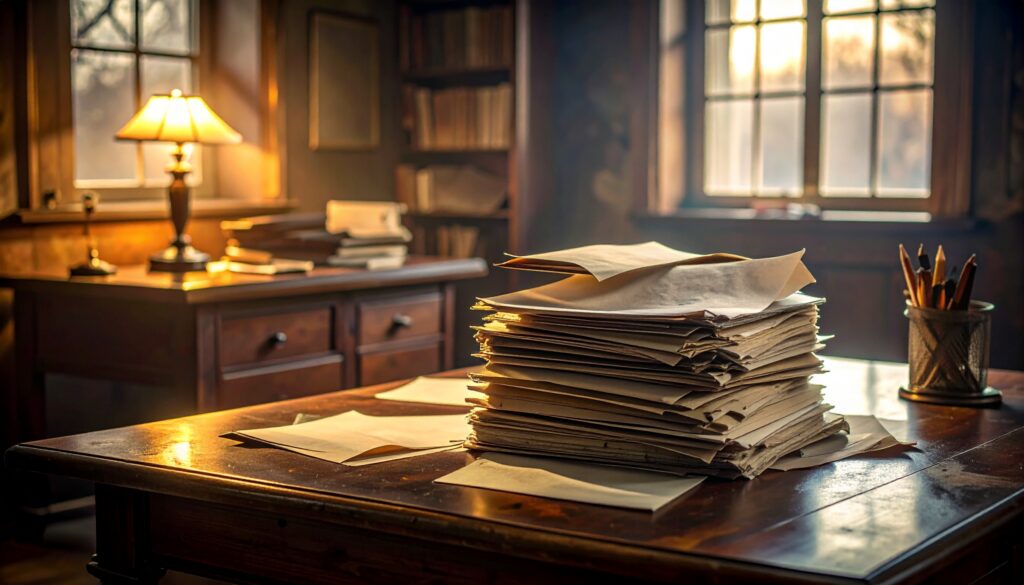
Technologische Lösungen für Transparenz
Die Studie verweist auf mehrere technische Ansätze, die bereits existieren, aber kaum flächendeckend umgesetzt sind. Persistent Identifier wie DOI, ORCID und ROR bieten die Möglichkeit, Publikationen, Autorinnen und Institutionen eindeutig zu verknüpfen. Wenn diese Systeme konsistent gepflegt würden, ließen sich Frühveröffentlichungen klar markieren und automatisch aktualisieren. Blockchain-Technologien könnten zusätzlich dafür sorgen, dass Änderungen in Metadaten lückenlos nachvollziehbar bleiben. Jede Version eines Artikels ließe sich zeitlich signieren, jede Korrektur historisch rückverfolgen. Derartige Systeme existieren in Pilotprojekten, scheitern aber oft an mangelnder Kooperation zwischen Verlagen und Datenbankbetreibern. Zhu betont, dass Transparenz kein technologisches, sondern ein organisatorisches Problem ist.
Wissenschaftspolitik und institutionelle Verantwortung
Die Verantwortung für die Lösung liegt nicht allein bei den Datenbanken. Hochschulen, Forschungsförderer und Fachgesellschaften müssen anerkennen, dass Bewertungsmechanismen selbst Teil der Verzerrung sind. Wenn Impact-Faktoren und H-Indizes weiterhin als zentrale Leistungsindikatoren gelten, werden technische Vorteile strukturell belohnt. Die Politik der schnellen Sichtbarkeit fördert jene, die sich den Takt der Systeme zunutze machen. Eine Reform müsste daher an der Wurzel ansetzen: der Bewertung wissenschaftlicher Qualität. Institutionen könnten künftig stärker qualitative Kriterien berücksichtigen – Reproduzierbarkeit, Datentransparenz, gesellschaftliche Wirkung – statt bloß numerischer Metriken. Erst wenn Tempo und Qualität getrennt werden, kann Frühveröffentlichung ihren eigentlichen Zweck erfüllen: Wissen zugänglich zu machen, nicht Wettbewerb zu beschleunigen.
Bildung und Bewusstsein für Open Science
Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, dass viele Forschende die Mechanismen hinter Publikationsdaten kaum kennen. Frühveröffentlichungen werden als neutrale Phase wahrgenommen, ohne Bewusstsein für ihre strukturelle Bedeutung. Eine moderne Wissenschaftsausbildung sollte den Umgang mit Metadaten, Zitationssystemen und digitalen Identifikatoren daher stärker in den Fokus rücken. Open Science ist nicht nur eine Frage der Zugänglichkeit, sondern auch des Verständnisses der Infrastruktur. Wer weiß, wie Datenbanken funktionieren, kann sie kritisch nutzen und Fehler erkennen. Wissenschaftskommunikation muss sich in Zukunft nicht nur an die Öffentlichkeit, sondern auch nach innen richten – zu jenen, die Wissenschaft produzieren und verbreiten.
Gesellschaftliche Implikationen der Beschleunigung
Zhus Arbeit ist mehr als eine technische Studie. Sie beschreibt ein Paradigma, das weit über Forschung hinausreicht. Der Druck zur ständigen Aktualität betrifft alle Wissensbereiche – von Medien über Politik bis Bildung. Frühveröffentlichungen sind Ausdruck eines gesellschaftlichen Rhythmus, der keine Pausen kennt. Wissenschaft, einst Synonym für geduldiges Prüfen, wird selbst zum Teil eines Echtzeit-Ökosystems. Der Wert einer Entdeckung bemisst sich zunehmend an ihrer Geschwindigkeit. Diese kulturelle Verschiebung verändert, wie Wissen entsteht, zirkuliert und konsumiert wird. Die Gefahr liegt darin, dass das Publikum die Unterscheidung zwischen Vorläufigkeit und Verlässlichkeit verliert. Wissenschaftliche Sprache wird temporär, obwohl sie dauerhaft wirken soll.
Neuorientierung durch Standards und Ethik
Die Lösung liegt nicht allein in technischen Reformen, sondern in einem ethischen Selbstverständnis. Wissenschaft muss sich selbst Grenzen setzen, wo Technologie keine bietet. Frühveröffentlichung darf nicht zum Ersatz für Qualitätssicherung werden. Ein klar definiertes Ethos könnte festlegen, welche Version eines Artikels zitierfähig ist, wie Änderungen transparent gemacht und welche Daten offen zugänglich sein müssen. Zhus Studie liefert dafür die empirische Grundlage: Nur wo Publikationsprozesse nachvollziehbar bleiben, bleibt auch Vertrauen bestehen. Einheitliche Standards wären der erste Schritt, doch ohne ethische Verbindlichkeit bleiben sie wirkungslos. Die Zukunft der Forschung hängt davon ab, ob sie Transparenz als moralisches Prinzip begreift, nicht nur als technische Option.
Perspektive einer datengetriebenen Wissenschaft
Die Digitalisierung eröffnet gleichzeitig neue Möglichkeiten. Frühveröffentlichungen erlauben schnelle Reaktion auf Krisen, wie etwa bei Pandemien oder Klimadaten. Wenn sie sauber dokumentiert sind, können sie zum Werkzeug kollektiver Intelligenz werden. Automatisierte Systeme könnten den Forschungsfluss in Echtzeit überwachen, neue Trends identifizieren und Fehlentwicklungen früh erkennen. Doch diese Potenziale entfalten sich nur, wenn die zugrunde liegenden Daten verlässlich sind. Zhu weist darauf hin, dass Datenqualität das nächste große Thema der Wissenschaftspolitik wird. Die Frage lautet nicht mehr, wie viel Wissen generiert wird, sondern wie korrekt die Strukturen sind, die es verwalten.
Wissenschaftliche Glaubwürdigkeit als gemeinsame Ressource
Vertrauen ist die unsichtbare Währung der Wissenschaft. Wenn unterschiedliche Systeme denselben Artikel verschieden datieren, erodiert dieses Vertrauen schleichend. Leserinnen, Forschende und Institutionen müssen sich darauf verlassen können, dass ein Datum bedeutet, was es vorgibt zu bedeuten. Frühveröffentlichungen zeigen, wie fragil dieses Vertrauen geworden ist. Die Reparatur verlangt kollektives Handeln – technische Präzision, organisatorische Kooperation und ethische Selbstverpflichtung. Die Studie von Yunu Zhu erinnert daran, dass Wissenschaft nicht nur Wissen produziert, sondern auch eine Kultur der Genauigkeit pflegen muss.
Fazit
Die Beschleunigung der Wissenschaft ist irreversibel, doch ihre Richtung bleibt gestaltbar. Frühveröffentlichungen sind weder Problem noch Lösung, sondern Prüfstein eines Systems, das sich neu erfinden muss. Die Arbeit von Yunu Zhu offenbart die Schwachstellen einer Infrastruktur, die schneller kommuniziert, als sie ordnen kann. Ihre Analyse fordert eine Rückbesinnung auf Transparenz, Nachvollziehbarkeit und gemeinsame Standards – Prinzipien, die einst die Stärke der Wissenschaft ausmachten. Geschwindigkeit darf kein Ersatz für Klarheit werden. Die Zukunft wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit hängt davon ab, ob Offenheit mit Präzision versöhnt werden kann.
Originalstudie (Open Access):
PLOS ONE – An exploratory study on the publication stages of early access articles in different bibliographic databases (2025)



